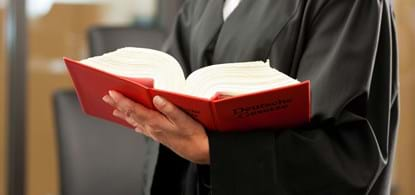+++ Echte Wahlfeststellung +++ In dubio pro reo, Art. 6 II EMRK +++ Gesetzlichkeitsprinzip, Art. 103 II GG +++ Diebstahl, § 242 StGB +++ Hehlerei, § 259 StGB +++
Sachverhalt (vereinfacht): Im Rahmen von Durchsuchungen war bei A Diebesgut sichergestellt worden. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft A wegen Diebstahls oder Hehlerei in 19 Fällen angeklagt. Die Strafkammer gelangt zu der Überzeugung, dass A entweder als Mittäter an den jeweiligen Diebstählen beteiligt war, oder die Gegenstände durch Hehlerei erlangt hatte. In jedem Fall handelte A gewerbsmäßig.
Strafbarkeit von A nach dem StGB?
A) Sounds
1. Die richterrechtlich entwickelte Rechtsfigur der ungleichartigen (echten) Wahlfeststellung verstößt gegen Art. 103 II GG.
2. Eine wahldeutige Verurteilung wegen (gewerbsmäßigen) Diebstahls oder gewerbsmäßiger Hehlerei ist daher unzulässig.
B) Problemaufriss
Der vorliegende Fall eignet sich hervorragend, um sich die Probleme im Umgang mit Sachverhaltsungewissheiten zu vergegenwärtigen. Dieser Bereich wird im Studium weitgehend außen vor gelassen, da in Klausuren bzw. Hausarbeiten der Sachverhalt vollständig und umfassend vorgegeben ist. Allerdings sieht dies in der strafgerichtlichen Praxis völlig anders aus. Aufgrund der begrenzten menschlichen Erkenntnisfähigkeit und der meist nicht eindeutigen Sachlage spielt der Umgang mit Sachverhaltsungewissheiten vor allem für Praktiker eine große Rolle, was nicht zuletzt daran liegt, dass das Urteil nur auf Tatsachen gestützt werden kann, die nach Überzeugung des Gerichts wahrheitsgemäß feststehen (§§ 244 II, 261 StPO). Bei verbleibenden Zweifeln ist in dubio pro reo (Art. 6 II EMRK) zugunsten des Angeklagten zu entscheiden. In einigen Konstellationen führt die Anwendung dieses Grundsatzes zu unvertretbaren Ergebnissen. Genau um eine solche Konstellation handelt es sich im vorliegenden Fall.
Im Folgenden wird vor allem die echte Wahlfeststellung als richterrechtlich entwickeltes Institut betrachtet. Nichtsdestotrotz soll auch auf andere Fallkonstellationen, bei denen Sachverhaltsungewissheiten auftreten, eingegangen werden, da systematisches Verständnis in diesem Bereich unerlässlich ist. Nur mit diesem systematischen Verständnis kann es gelingen, sachgerechte Ergebnisse zu erzielen. Zumal diese Thematik immer wieder auch in Examensklausuren eine Rolle spielt,1 ist es ratsam, sich vor allem mit dem abweichenden Aufbau in einem solchen Spezialfall zu befassen.
C) Lösung
Zu prüfen ist die Strafbarkeit von A nach dem StGB.
I. Strafbarkeit gemäß §§ 242 I, 25 II, 243 I S. 2 Nr. 3 StGB
Zunächst ist die Strafbarkeit des A wegen mittäterschaftlich begangenen gewerbsmäßigen Diebstahls nach §§ 242 I, 25 II, 243 I S. 2 Nr. 3 StGB zu untersuchen. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass eine mittäterschaftliche Beteiligung an den Diebstählen nicht erwiesen ist. Schließlich könnte A die Gegenstände auch durch Hehlerei erlangt haben. Es ist somit in dubio pro reo davon auszugehen, dass A sich das Diebesgut in anderer Art und Weise verschafft hat. Die nach § 261 StPO erforderliche Überzeugungsbildung kann in Bezug auf eine Strafbarkeit wegen Diebstahls aus diesem Grund nicht gelingen. Die Entscheidung bezüglich des ungewissen Merkmals hat zugunsten des A auszufallen.
Zwischenergebnis: A hat sich demzufolge nicht wegen Diebstahls in Mittäterschaft gemäß §§ 242 I, 25 II, 243 I S. 2 Nr. 3 StGB strafbar gemacht.
hemmer-Methode: Der Hinweis, dass aufgrund der vorliegenden Sachverhaltsangaben eine Überzeugung (§ 261 StPO) nicht gelingen kann, zeigt dem Korrektor, dass das hinter dem Straf(prozess)recht stehende Wertungssystem verstanden wurde.
II. Strafbarkeit gemäß §§ 259 I, 260 I Nr. 1 StGB
A könnte sich jedoch wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gemäß §§ 259 I, 260 I Nr. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er sich das Diebesgut verschafft hat. Aber auch diesbezüglich erweist sich aufgrund der Sachverhaltsangaben eine Überzeugungsbildung nach § 261 StPO als nicht möglich. In dubio pro reo ist von einer Mittäterschaft nach §§ 242 I, 25 II, 243 I S. 2 Nr. 3 StGB auszugehen, die eine Strafbarkeit nach §§ 259 I, 260 I Nr. 1 StGB ausschließt („Der Hehler ist kein Stehler!"). Das liegt am Strafgrund der Hehlerei. Dieser besteht in der Perpetuierung einer rechtswidrigen Vermögenslage.2 Hat A jedoch am Diebstahl mitgewirkt, so kann er sich nicht wegen Hehlerei strafbar machen, da er die rechtswidrige Vermögenslage bereits selbst geschaffen hat und damit der Strafgrund der Hehlerei als eigenständiger Unrechtsgehalt nicht mehr eintreten kann. Zudem lässt sich dies dem Wortlaut des § 259 I StGB entnehmen, wonach ein „anderer" die Vortat begangen haben muss.
Zwischenergebnis: A hat sich demzufolge nicht wegen gewerbsmäßiger Hehlerei nach §§ 259 I, 260 I Nr. 1 StGB strafbar gemacht.
III. Strafbarkeit gemäß §§ 242, 25 II, 243 I S. 2 Nr. 3 StGB oder §§ 259 I, 260 I Nr. 1 StGB
A könnte sich jedoch strafbar gemacht haben wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Mittäterschaft gemäß §§ 242 I, 25 II, 243 I S. 2 Nr. 3 StGB oder gewerbsmäßiger Hehlerei gemäß §§ 259 I, 260 I Nr. 1 StGB, indem er die Sachen entweder selbst gestohlen oder durch eine Hehlerei erlangt hat. Für eine derartige alternative Verurteilung wäre es jedoch erforderlich, dass die Voraussetzungen der echten Wahlfeststellung erfüllt sind. Die bisher wohl h.M. fordert, dass die in Betracht zu ziehenden Straftaten rechtsethisch und psychologisch vergleichbar sind.3
Schema: Voraussetzungen der echten Wahlfeststellung
- Eindeutige Feststellung des Sachverhalts unmöglich
- Alternative Verwirklichung von zwei Tatbeständen ist sicher
- Kein Stufenverhältnis Ein Stufenverhältnis liegt dann vor, wenn die alternativen Straftatbestände in einem Verhältnis eines „Mehr" oder „Weniger" zueinander stehen, oder wenn ein Straftatbestand von einem anderen voll umfasst wird (Bsp.: Grunddelikt -- Qualifikation; Versuch -- Vollendung; Diebstahl - Raub). In diesen Fällen wäre in dubio pro reo aus dem „Weniger" bzw. aus dem „umfassten" Straftatbestand zu bestrafen.
- Rechtsethische Gleichwertigkeit der Straftaten Eine solche liegt bei annähernd gleicher Schwere des möglichen Schuldvorwurfs, d.h. bei gleicher Strafwürdigkeit, vor. Den möglichen Taten muss im allgemeinen Rechtsempfinden eine gleiche oder doch ähnliche sittliche Bewertung zuteil kommen; dabei genügt es, wenn durch die in Betracht kommenden Verhaltensweisen dieselben oder in ihrem Wesen ähnliche Rechtsgüter verletzt werden.
- Psychologische Gleichwertigkeit der Straftaten Diese erfordert eine gleichgeartete seelische Beziehung des Täters zu den mehreren in Frage stehenden Tatvorwürfen. Sie liegt vor, wenn die Einstellung des Täters zu den Rechtsgütern und die Motivationslage ähnlich sind.
Der BGH hatte die echte Wahlfeststellung in Bezug auf Diebstahl und Hehlerei ausdrücklich zugelassen.4 Im vorliegenden Fall ist jedoch zu problematisieren, inwieweit es sich auswirkt, dass A gewerbsmäßig handelte. Im Rahmen des Diebstahls stellt die Gewerbsmäßigkeit nach § 243 I S. 2 Nr. 3 StGB nämlich eine Strafzumessungsvorschrift dar, wohingegen es sich bei § 260 I Nr. 1 StGB um einen Qualifikationstatbestand zu § 259 I StGB handelt. Doch auch dieser Unterschied änderte laut bisheriger Rechtsprechung nichts an der Zulässigkeit der ungleichartigen Wahlfeststellung bei gewerbsmäßigem Diebstahl bzw. gewerbsmäßiger Hehlerei.5
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen kann jedoch dahinstehen, wenn man die richterrechtlich entwickelte Rechtsfigur der echten bzw. ungleichartigen Wahlfeststellung als unzulässig erachtet. Die Frage der Zulässigkeit hängt in Ermangelung einer gesetzlichen Regelung entscheidend davon ab, wie die miteinander kollidierenden Interessen innerhalb der Abwägung gewichtet werden. Dabei treten die Rechtssicherheit zum einen und die Einzelfallgerechtigkeit i.V.m. kriminalpolitischen Bedürfnissen zum anderen in einen Interessenswiderstreit.6 Bedenken ergeben sich vor allem im Hinblick auf Art. 103 II GG. Diese Problematik soll im Folgenden im Vordergrund stehen.
Anmerkung: Die Wahlfeststellung war bereits Inhalt einer gesetzlichen Regelung (§ 2b RStGB), die am 28.06.1935 verabschiedet worden ist. Diese Norm wurde als typisch nationalsozialistisches (Un-)Recht durch Gesetz des Alliierten Kontrollrats Nr. 11 vom 30.01.1946 aufgehoben. Die Tatsache, dass der BGH die Wahlfeststellung unter Berufung auf die frühere Rechtsprechung des RG zugelassen hat, ist daher nicht unproblematisch.
1. Sachlicher Schutzbereich des Art. 103 II GG
Zunächst ist der Anwendungsbereich des Art. 103 II GG auszuloten. Demnach kann eine Tat nämlich nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Aus der Vorschrift lassen sich zwei verschiedene Zweckrichtungen herauslesen: Zum einen soll der Normadressat erkennen können, welches Verhalten unter Strafe gestellt ist, und zum anderen wird durch Art. 103 II GG festgelegt, dass nur der parlamentarische Gesetzgeber darüber entscheidet, welche Handlungsweisen strafbar sind.7 Darüber hinaus beschränkt sich Art. 103 II GG nur auf die materiellen Voraussetzungen der Strafbarkeit bzw. der Strafandrohung und dementsprechend auf materielles Strafrecht.8 Auch das Richterrecht ist an Art. 103 II GG zu messen, sofern es materiell-rechtlicher Natur ist.9
Anmerkung: Art. 103 II GG enthält folgende Aussagen:
1. nulla poena sine lege (absolutes Verbot der Rückwirkung, Ausn.: Amnestie)
2. nulla poena sine lege scripta (Verbot von Gewohnheitsrecht und strafverschärfender Analogie)
3. Nulla poena sine lege certa (Bestimmtheitsgrundsatz)
2. Ist Art. 103 II GG Prüfungsmaßstab für die echte Wahlfeststellung?
Zu problematisieren ist hierbei zunächst, inwiefern der sachliche Schutzbereich des Art. 103 II GG eröffnet ist bzw. ob die echte Wahlfeststellung den daraus erwachsenden Anforderungen entspricht.
a) Verstoß gegen Art. 103 II GG in Bezug auf den Tatbestand
Da sich Art. 103 II GG nur auf materielles Strafrecht bezieht, muss im Folgenden erörtert werden, ob die echte Wahlfeststellung ein richterrechtliches Institut prozessualen oder materiell-rechtlichen Charakters darstellt.
Das materielle Strafrecht umfasst die Gesamtheit der Rechtsnormen, die bestimmte, für das gesellschaftliche Zusammenleben als schädlich angesehene Handlungen definieren und unter Strafe stellen sowie die Art und das Maß der Strafe anordnen.10 Das Strafverfahrensrecht betrifft dagegen die verfahrensmäßigen Voraussetzungen der Verfolgung von Straftaten sowie die Art und Weise ihrer Durchführung.
Aufgrund der Tatsache, dass Art. 103 II GG nur materielles Strafrecht umfasst, wird von den Befürwortern der echten Wahlfeststellung argumentiert, dass es sich um eine prozessuale Gestaltung handeln würde. Bei der Unsicherheit bezüglich des verwirklichten Tatbestandes ginge es nur um eine reine Beweisfrage, die prozessrechtlicher Natur sei. Schließlich seien auch die alternativ in Frage kommenden Delikte -- von denen eines tatsächlich begangen wurde -- gesetzlich geregelt und die tatbestandlichen Voraussetzungen bzw. die Strafandrohung vor der Tat hinreichend bestimmt, weswegen ein Verstoß gegen Art. 103 II GG nicht gegeben sei.11 Eine vermittelnde Ansicht sieht in der echten Wahlfeststellung ein gemischt sachlich-/verfahrensrechtliches Rechtsinstitut, da durch die Wahlfeststellung sowohl der verfahrensrechtliche in dubio pro reo-Grundsatz als auch der materiell-rechtliche nullum-crimen Grundsatz modifiziert werden, sodass eine alternative Zuordnung in eine Kategorie (prozessual oder materiell-rechtlich) nicht als möglich erscheint.12
Diese Argumente vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Die echte Wahlfeststellung wirkt vielmehr im materiell-rechtlichen Sinn strafbarkeitsbegründend. Sie ist anders als der Zweifelssatz keine Entscheidungsregel, sondern ermöglicht bei exklusiver Sachverhaltsalternativität neben einer bestimmten Verurteilung und einem Freispruch eine dritte Variante. Sind nämlich die Voraussetzungen der alternativen Tatbestände -- wie im vorliegenden Fall bei Diebstahl und Hehlerei -- nicht zur Überzeugung des Gerichts feststellbar, werden die entsprechenden Normen nicht angewendet und es erfolgt eine Verurteilung aufgrund eines gemeinsamen Unrechtskerns. Das liegt daran, dass wegen der exklusiven Tatalternativen nur dahingehend Gewissheit besteht, dass der Täter Unrecht begangen hat. Welche Strafnorm verletzt wurde, kann gerade nicht geklärt werden. Die Strafbarkeit erfolgt dann faktisch auf Basis eines ungeschriebenen dritten Strafgesetzes, welche die übereinstimmenden Unrechtselemente der nicht angewendeten Normen (hier: § 242 I StGB bzw. § 259 I StGB) in sich vereinigen soll. Dadurch kommt es zu einer Nichtbeachtung der Ausdifferenzierung und Unterscheidung strafrechtlichen Unrechts, die durch die verschiedenen Straftatbestände vom Gesetzgeber geschaffen wurde.13
Das fehlende gemeinsame Tatbestandsmerkmal wird mittels sog. rechtsethischer und psychologischer Vergleichbarkeit ergänzt. Dieses Merkmal schließt die Lücken zwischen den alternativ in Frage kommenden Straftatbeständen und erfüllt die Aufgabe eines Tatbestandsmerkmals im Rahmen der ungeschriebenen dritten Strafnorm.14 Man muss somit erkennen, dass die echte Wahlfeststellung dazu führt, dass ein anderes materielles Ergebnis erzielt wird, als es das positive Recht normalerweise zulassen würde. Deshalb lässt es sich vertreten, dass die echte Wahlfeststellung gegen Art. 103 II GG verstößt, weil es sich nicht nur um eine prozessuale Entscheidungsregel, sondern um eine sachlich-rechtliche Strafbarkeitsregel handelt, die dem Gesetzesvorbehalt unterliegt.
b) Verstoß gegen Art. 103 II GG in Bezug auf die Rechtsfolgen
Außerdem ist zu beachten, dass wegen Art. 103 II GG auch die Grundlagen der Strafbemessung eindeutig sein müssen. Aus dem Gesetz müssen somit nicht nur der Tatbestand und der Strafrahmen erkennbar sein, sondern vielmehr auch die Leitgesichtspunkte, auf deren Basis die Zumessung der Strafe innerhalb des Strafrahmens auf Rechtsfolgenseite zu resultieren hat.15 Nach § 46 I S. 1 StGB ist die Schuld des Täters Grundlage für die Zumessung der Strafe. Für eine der Schuld angemessene Strafe genügt jedoch nicht ein quantitativer Strafrahmenvergleich zwischen den in Frage kommenden Straftatbeständen. Bleibt für das Gericht unaufklärbar, welche Unrechtshandlung begangen wurde und welche Strafnorm einschlägig ist, so kann auf Basis einer nur per Saldo festgestellten Schuld des Täters keine zulässige Strafzumessung erfolgen. Der Strafgrund liegt in der konkret begangenen Tat, die auch aus diesem Grund nicht durch die gesetzesalternative Verurteilung offen gelassen werden darf.16 Somit unterliegt auch der Strafzumessungsvorgang, der auf der Rechtsfolgenseite anzusiedeln ist, essentiellen Ungenauigkeiten, die zur Unvereinbarkeit der echten Wahlfeststellung mit dem Grundgesetz führen.
3. Rechtfertigung des Eingriffs in das strafrechtliche Gesetzlichkeitsprinzip aus Art. 103 II GG?
Nachdem festgestellt ist, dass die echte Wahlfeststellung in den Schutzbereich des Art. 103 II GG eingreift, drängt sich die Frage auf, ob dieser Eingriff zu rechtfertigen ist. Allerdings enthält Art. 103 II GG keine Schranke, die eine richterrechtliche Ausnahme gestatten könnte; schließlich hat sich der Verfassungsgeber für einen uneingeschränkten Gesetzesvorbehalt im Bereich des Strafrechts entschieden. Ein Eingriff in dieses absolut geltende strafrechtliche Gesetzlichkeitsprinzip aus Art. 103 II GG, welches ein grundrechtsgleiches Recht darstellt, kann nicht durch Einzelfallerwägungen gerechtfertigt werden. Es ist nicht zulässig, das Gesetzlichkeitsprinzip deswegen richterrechtlich zu beschränken, weil Gerechtigkeitsüberlegungen und kriminalpolitische Erwägungen dies als erforderlich ansehen. Das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden und die Behauptung eines Strafbedürfnisses können keine Aufweichung des Gesetzlichkeitsprinzips entschuldigen, zumal das Grundgesetz diese Abwägung schon zugunsten der Rechtssicherheit und des Parlamentsvorbehalts entschieden hat.17
Allerdings wird nicht selten von einer Legitimation der echten Wahlfeststellung ausgegangen, weil der Gesetzgeber absichtlich auf eine gesetzliche Regelung verzichtet hat und eine entsprechende Lösung der Problematik den Praktikern überließ.18 Jedoch kann man diese Auffassung nicht teilen, da der Gesetzgeber sich nicht durch Verweis auf Richterrecht der Aufgabe entziehen darf, die Voraussetzungen der Strafbarkeit selbst zu bestimmen. Dies würde der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung widersprechen.
Zwischenergebnis: Die wahlweise Verurteilung steht in einem Spannungsverhältnis zu der Verfassungsgarantie des Art. 103 II GG, wonach der Schuldspruch wegen einer Straftat auf den Verstoß gegen ein bestimmtes Gesetz gestützt werden muss. Eine Analogie zu Lasten des A, also eine Verurteilung wegen eines vergleichbaren Verstoßes -- auf Basis einer dritten ungeschriebenen Strafnorm -- ist unzulässig. Die richterrechtlich entwickelte Rechtsfigur der echten bzw. ungleichartigen Wahlfeststellung verstößt demzufolge gegen Art. 103 II GG und ist verfassungswidrig.
4. Ergebnis
Eine wahldeutige Verurteilung wegen (gewerbsmäßigen) Diebstahls gemäß §§ 242 I, 25 II, 243 I S. 2 Nr. 3 StGB bzw. gewerbsmäßiger Hehlerei nach §§ 259 I, 260 I Nr. 1 StGB scheidet somit aus.
Anmerkung: Ginge man -- wie die bisherige Rechtsprechung -- von der Verfassungsmäßigkeit der echten Wahlfeststellung aus, würde der Tenor bei Vorliegen der Voraussetzungen folgendermaßen lauten: „Der Angeklagte ist des Diebstahls oder der Hehlerei schuldig."
IV. Strafbarkeit gemäß § 246 I StGB
A könnte sich jedoch nach den Regeln der unechten bzw. gleichartigen Wahlfeststellung wegen Unterschlagung gemäß § 246 I StGB strafbar gemacht haben.
Anmerkung: Im Original beschränkt sich die Anfrage des Senats auf die echte Wahlfeststellung, ohne auf § 246 StGB einzugehen. Dies ist in einer Gutachtenklausur jedoch nicht möglich. Zu beachten ist aber, dass die Unterschlagung als Auffangtatbestand das Problem nicht grundsätzlich beseitigt, da es auch andere Fälle der echten Wahlfeststellung gibt, die nicht über § 246 I StGB gelöst werden können. Außerdem ist über § 246 I StGB nur ein deutlich geringeres Strafmaß abgedeckt als über § 242 I StGB bzw. § 259 I StGB.
a) Objektiver Tatbestand
Hierzu müsste der objektive Tatbestand erfüllt sein. Beim Diebesgut handelt es sich für A zweifellos um eine fremde bewegliche Sache. A müsste sich die Sache rechtswidrig zugeeignet haben. Der Täter eignet sich die Sache i.S.d. § 246 I StGB nur zu, wenn sich sein Zueignungswille objektiv manifestiert, d.h. wenn er Handlungen vornimmt, die ein objektiver Betrachter als Zueignungsakt (= Aneignung plus Enteignung) verstehen muss.19 Zu erörtern ist somit, ob der mögliche Diebstahl oder die mögliche Hehlerei eine solche Manifestation des Zueignungswillens darstellen. Davon muss ausgegangen werden, da sowohl beim Diebstahl als auch beim hehlerischen Erwerb durch A Handlungen vorgenommen wurden, die objektiv einen rechtswidrigen Zueignungswillen erkennen lassen. Somit hat A auf die eine oder andere Weise den Tatbestand des § 246 I StGB erfüllt.
Allerdings ist noch nicht geklärt, durch welche Handlung dies geschehen ist. Dieses Problem kann durch die unechte (gleichartige) Wahlfeststellung aufgelöst werden. Die unechte Wahlfeststellung (auch Tatsachenalternativität oder gleichartige Wahlfeststellung genannt) ist dann gegeben, wenn zwar eine Sachverhaltsungewissheit, aber keine Rechtsnormungewissheit besteht. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Täter einen Straftatbestand verwirklicht hat und nur nicht feststeht, durch welche seiner Handlungen.20 Genau diese Situation ist im vorliegenden Fall eingetreten. Der objektive Tatbestand des § 246 I StGB ist somit erfüllt.
b) Subjektiver Tatbestand
A handelte auch mit Wissen und Wollen hinsichtlich der rechtswidrigen Zueignung der fremden Sachen, sodass der subjektive Tatbestand als erfüllt anzusehen ist.
c) Rechtswidrigkeit und Schuld
Mangels ersichtlicher Rechtfertigungs-, Schuldausschließungs- und Entschuldigungsgründe ist die Tat des A rechtswidrig und schuldhaft.
Zwischenergebnis: A hat sich demzufolge wegen Unterschlagung gemäß § 246 I StGB strafbar gemacht, indem er sich das Diebesgut jedenfalls zueignete.
Anmerkung: Im Normalfall tritt die Unterschlagung subsidiär hinter dem Diebstahl oder der Hehlerei zurück, weshalb es durchaus berechtigt ist, die Frage aufzuwerfen, ob dies nicht auch im vorliegenden Fall gilt. Schließlich kann man von der Strafbarkeit wegen Diebstahls oder Hehlerei ausgehen, sodass die Unterschlagung nicht zur Anwendung käme. Allerdings würde A dann davon profitieren, dass er möglicherweise schwereres Unrecht in Form eines Diebstahls oder einer Hehlerei begangen hat. Auch wenn § 246 StGB als bloßer Auffangtatbestand konzipiert ist,21 darf dies trotzdem in einem solchen Fall nicht dazu führen, dass die Subsidiaritätsklausel angewandt wird. Begründend hierfür lässt sich der Grundgedanke der Postpendenz anführen (vgl. hierzu Wiederholungsfrage 1).
V. Ergebnis
A ist strafbar wegen Unterschlagung gemäß § 246 I StGB in 19 Fällen.
D) Kommentar
(bb). Die vorliegende Falldarstellung orientiert sich stark an der Diktion des Anfragebeschlusses. Da der anfragende 2. Strafsenat mit der bisherigen ständigen BGH-Rechtsprechung brechen möchte, hat er gem. § 132 III GVG bei den anderen Senaten des BGH angefragt, ob diese an ihrer entgegenstehenden Rechtsauffassung festhalten wollen. Wäre dies der Fall, so müsste der Große Senat für Strafsachen auf Vorlage über die Frage entscheiden.
Praktikabilitätserwägungen sprechen sicher für eine Beibehaltung der Rechtsfigur. Es darf mit Spannung abgewartet werden, wie sich die anderen Strafsenate hier dogmatisch positionieren.
Aufgrund der überragenden Bedeutung der Rechtsfigur der echten (bzw. ungleichartigen) Wahlfeststellung in der Praxis sollten Sie unbedingt die weitere Entwicklung im Blick behalten. Es ist sicherlich auch mit einer entsprechenden Examensrelevanz (vor allem im Zweiten Staatsexamen) zu rechnen.
hemmer-Methode: Eine weitergehende Darstellung zum Umgang mit den verschiedenen Arten von Sachverhaltsungewissheiten finden Sie bei Berberich/Schmidt, Life & Law 2009, 555 ff.
E) Zur Vertiefung
- In dubio pro reo und Wahlfeststellung Hemmer/Wüst, Strafrecht AT II, Rn. 408 ff.
- In dubio pro reo und Wahlfeststellung Hemmer/Wüst, Karteikarten Strafrecht AT II, Nr. 170 -- 174
F) Wiederholungsfragen
- Was versteht man unter Prä- bzw. Postpendenz?
- Was ist unter unechter Wahlfeststellung zu verstehen?
-
Etwa im Termin des 1. Staatsexamens 2013/1 (Bayern).↩
-
Schönke/Schröder, § 259 StGB, Rn. 1.↩
-
BGHSt 9, 394; 23, 260; 25, 182↩
-
BGHSt 1, 302.↩
-
BGHSt 11, 26, 28.↩
-
Schönke/Schröder, § 1 StGB, Rn. 64.↩
-
BVerfGE 126, 170, 194 f.↩
-
Kudlich/Montiel/Schuhr (Hrsg.), Gesetzlichkeit und Strafrecht, 2012, S. 233, 239 ff. m.w.N.↩
-
BGHSt 42, 235, 241.↩
-
BVerfGE 109, 190, 212↩
-
Wolter, GA 2013, 271, 273 f.↩
-
Schönke/Schröder, § 1 StGB, Rn. 68.↩
-
A.A. Schönke/Schröder, § 1 StGB, Rn. 67 m.w.N.↩
-
BGH, Beschluss vom 28.01.2014 -- 2 StR 495/12, Rn. 28↩
-
BVerfGE 105, 135, 164↩
-
BGH, Beschluss vom 28.01.2014 -- 2 StR 495/12, Rn. 35 f.↩
-
BGH, Beschluss vom 28.01.2014 -- 2 StR 495/12, Rn. 31 f.↩
-
BT- Drs. I/3713, S. 19.↩
-
Schönke/Schröder, § 246 StGB, Rn. 10 ff.↩
-
Schönke/Schröder, § 1 StGB, Rn. 60 ff.↩
-
BT- Drs. 13/8587, S. 43 f.↩